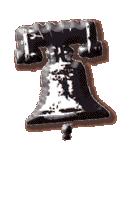|
" Stiftung Warentest " Glockenläutanlagen "Früher war alles aus Holz" sagte Oma Krause, als man ihr die Programmierung der hoch modernen Steueruhr Himmelszeit und die Bedienung der mit Mikroprozessoren und SMD-Raumfahrthalbleitertechnik vollgestopften sowie kirchenbehördlich heilig gesprochenen Glockenläutemaschine ” Turbotronic 2000: Ich gebe der Glocke Sanctus “ versuchte, zu erklären. Bringt der Einsatz von Elektronik wirklich das ersehnte Glück? Müssen 3 Tonnenglocken innerhalb von 10 Sekunden läuten? Antworten auf diese Fragen mit zusätzlichen Informationen im folgenden Bericht. Grundlegende Informationen für den Laien. Eine Kirchenglocke ist ein geweihtes Musikinstrument. Ihre Entwicklung bedurfte ca 200 Jahre, bis das die bekannte Form mit dem heutigen gewohnten Klang entstanden war. Die ersten Glocken kamen aus China, allerdings aus Blech geschmiedet und waren kein Ohrenschmaus. “ Wenn ich mit Engelszungen redete, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich wie tönend Erz (!) oder lärmendes Schlagzeug .... “ Biebelspruch Die ersten gegossenen Glocken, ca. 1100 n.Chr. hatten die Form eines Bienenkorbes und klangen etwas besser als eine Blechtonne. Dann bemühte man sich um klangliche Verbesserungen. Es entstanden die Zuckerhutglocken, die schon recht gut klangen. Dann kam die Birnenform und schließlich um 1400 n.Chr. die gotische Rippe. Sie ist die heute bekannte Glockenform. Mit dem Guß der Maria Gloriosa im 15. Jahrhundert n.Chr. war die Entwicklung abgeschlossen. Sie gilt als die beste Glocke, die jemals gegossen wurde. Charakteristisch für die gotische Rippe ist , daß die Höhe der Glocke ohne Krone gleich dem Durchmesser unten ist. Nachträgliche Experimente wie z.B. die französische Rippe mit erweitertem Durchmesser brachten keine besseren Ergebnisse mehr. Die Glocke besteht von oben nach unten gesehen aus der Krone, der Haube, der Flanke, dem Wolm, dem Schlagring und der Schärfe. Die Wandung verdickt sich von oben nach unten. Der Schlagring ist zugleich die dickste Stelle in der Glocke. Das Herstellungsverfahren ist nach alter Tradition noch wie früher, wo mit Lehmformen, die der Gießer vorher in Handarbeit anfertigt, gearbeitet wird. Das Glockenmaterial besteht aus einem Gemisch von 22% Zinn und 78 % Kupfer, die Glockenbronze, welche man schon seit dem 12. Jahrhundert verwendet. Nach dem Guß werden sie in die betreffende Gemeinde transportiert, wo sie in einer feierlichen Prozession von den Einwohnern empfangen und jede Glocke in der Glockenweihe auf dem Kirchplatz mit Weihwasser und Cresamöl einem Heiligen geweiht wird. Deshalb haben Glocken auch einen Namen. Meistens ist dieser als Inschrift beim Gießen mit eingegossen worden. Ebenso finden sich neben vielen Verzierungen auch Wünsche und Lobpreisungen auf der Wandung. Nach der Weihe zieht man die Glocken mit schwerem Gerät in den Turm. Der Glockenton fasziniert nicht nur den einfachen Mann, sondern er ist auch ein wissenschaftliches Rätsel. Er besteht aus dem primären Schlagton und den sogenannten Heultönern, die einen Dreiklang bilden. Darum redet man auch von der gotischen Dreiklangrippe. Der Schlagton selbst existiert nicht, da er aus einem Frequenzgemisch zusammengesetzt erst in unseren Ohren entsteht. Das haben neueste Studien festgestellt. Somit hört jeder als akustische Täuschung eine Glocke ganz individuell läuten. Glockengeläute werden vom Klang her nach Motiven gegossen, das sind festgelegte Klangfolgen. So gibt es z.B. das Motiv Te Deum oder das Motiv Ave Maria. Es entwickelten sich bestimmte Läuteordnungen, wie das Wetterläuten in dem Film “ Der Glockenkrieg “, wobei früher so mancher Glöckner vom Blitz erschlagen wurde oder das Baiern, wo die Glocken im Marschmusiktakt mit den Klöppeln angeschlagen werden und so eine zackige Melodie ertönt sowie natürlich unser heutiges Mittagsläuten: “Angelus” oder “Vater unser Läuten” genannt. Ebenso gab es aber auch früher Feuerglocken, meistens St. Florian geweiht, die aber durch die heutigen Sirenen abgelöst wurden. So individuell wie jeder einzelne eine Glocke hört, so individuell ist auch die Glocke selbst. Sie ist ein Unikat in Erscheinungsbild und Klangcharakter. Auch wenn man von einer Glocke die beste Kopie anfertigt, so klingt sie nicht so, wie ihre Zwillingsschwester. Eine in ihrer Ganzheit zerstörte Glocke, ist unwiderbringlich verloren. Das heißt, man kann eine Glocke ruhig in Stücke hauen und wieder zusammenschweißen. Sie ist dann wieder die selbe. Fehlt aber ein Stück und ersetzt dieses durch eine Nachbildung, so wird die Glocke nie wieder so sein, wie sie mal war. Ursache ist die einmalig verwendbare Tonform, welche zum Entfernen von der Glocke zerschlagen werden muß. “ Soll die Glocke auferstehn, so muß die Form in Stücke gehn “ Zitat aus Friedrich Schillers Glocke. Weiter verantwortlich sind dann noch individuelle Umstände beim Gießen und abkühlen. Diese Tatsache verdeutlicht den in den beiden Weltkriegen entstandenen kulturellen Schaden. Sehr viele Glocken wurden aus den Türmen geholt und zu Kanonen umgegossen, da sich die Glockenbronze dafür eignet. Deshalb gibt es aber auch Glocken, die mit Ersatzstoffen damals aus der Not heraus gegossen wurden, wie z. B. Stahl oder die Briloner Sonderbronze. Stahlglocken haben einen harten Klang und sind mächtig in ihrem Charakter im Vergleich zur weich klingenden Bronze. Dabei haben sie aber eine angenehme Eigenschaft: Sie sind fast unverwüstlich, überstehen Kirchturmbrände und nehmen einem falsches Läuten nicht so schnell übel, wo Bronzeglocken längst den Geist aufgeben ( Fachliteratur: Theo Fehn Der Glockenexperte ) . Bei der Briloner Sonderbronze, die fast die gleichen Klangeigenschaften wie die normale Glockenbronze hat, ist die Hälfte des Zinnanteiles durch Antimon, einem Quarzsand, ersetzt worden. Dadurch konnte der Briloner Glockengießer Herr Junker nach Kriegsende wesentlich billiger produzieren und wo bei anderen Gießereien nur ein Glockenguß im Monat war, hatte Herr Junker gleich 4 Stück. Darüber sind die Glockengießer heute noch sauer. Das Produkt war gut, hat aber den Nachteil, daß sich beim Gießen leicht Schlacke im Metall absetzt und die Glocken dann nicht so gut klingen. Darum gibt es unter den Sonderbronzegeläuten neben guten Klangkörpern auch ein paar “ Krücken “. Das Gießen mit Sonderbronze ist also aufwendiger und in unserer heutigen Zeit nicht mehr rentabel. Darum hat auch diese Gießerei in den 60 Jahren den Glockenguß eingestellt und existiert heute nicht mehr. Generell lassen sich Bronzeglocken schweißen, wenn sie gesprungen oder zerbrochen sind. Stahlglocken und Sonderbronzeglocken jedoch nicht. Trotz aller Anstrengungen bei der Verwendung alternativer Materialien, die man als eine historische und technische Leistung würdigen muß, an der wirklich fähige Glockentechniker beteiligt waren, ist die traditionelle Glockenbronze und die gothische Dreiklangrippe im Klang unübertroffen. Nepper, Schlepper und Bauernfänger Eine Glocke ist vom sachlichen her ein physikalisches Pendel, in dem ein zweites physikalisches Pendel - der Klöppel - aufgehangen ist. Im Vergleich zum mathematischen Pendel, besitzt das physikalische Pendel keinen Masseschwerpunkt, auf den irgendwelche Berechnungen konkret angesetzt werden können. Das bedeutet für die Praxis, daß eine Glocke in ihrer Schwingung nur näherungsweise mit Hilfe der Integral und Differentialrechnung bestimmt werden kann. Diese Tatsache hat somit Konsequenzen für die Antriebstechnik, wo die verwendete Läutemaschine dann individuell an die einzelne Glocke angepaßt werden muß. Hier gibt es meherere Philosophien, jede Firma kocht ihr eigenes Süppchen und preist ihre Meinung als Absolut an. Besonders die “ Großen “ können das sehr gut. Die Erklärung dafür ist ganz einfach: Es existieren keine DIN Vorschriften, wie z.B. Läutemaschinen gebaut werden müssen. Den “ Staatlich geprüften Glockentechniker “ als Ausbildungsberuf gibt es nicht, da die Handwerkskammer oder die Handelskammer diesen Beruf nicht aufgeführt haben. Jeder, der Lust hat, kann einen Glockenbetrieb eröffnen und Läutemaschinen bauen. Wieviel technischer Müll dabei raus kommt und das selbst renomierte 100 Jahre alte Firmen keine Garantie mehr sind für Qualität und Sicherheit, zeigen Erfahrungen und Klagen der vielen Gemeinden, die nicht nur auf billige Läutemaschinen, sondern auch auf schlechten Service von Monteuren der “Großen Firmen” reingefallen sind. Diese bauen z.B. nur Spezialteile ein, deren Funktionserklärung sich dem kleingeistigen Kirchenbesucher vollendet entzieht. Kein Wunder, da man die Monteure nicht vernünftig ausgebildet hat, sind sie mit der einwandfreien Beantwortung der Fragen schlicht und einfach überfordert. So können sie nur hoffen, an eine kleine Firma zu gelangen, deren Mitarbeiter sich mit Leib und Seele der Glockentechnik verschrieben und ein umfangreiches Fachwissen in den erforderlichen Bereichen Elektrotechnik, Metallverarbeitung, Werkstoffkunde, Zimmereiarbeiten, Lithurgie und Musik haben. Nur dann bedient sie ein guter “Glockentechniker”. Wenn aber ein Monteur oder ein Kundendienstleiter noch nicht mal das Ohmsche Gesetz beherscht, so lassen sie besser die Finger von der Firma. Das eben beschriebene ist noch von allem das kleinere Übel. Die in der Praxis angewendete gutmütig erscheinende in Zahlungnahme für ein paar hundert DM von alten Glocken, erst recht wenn es sich um eine alte Blechschepper aus dem 16. Jahrhundert oder auch um eine alte Stahlglocke aus der Vorkriegszeit handelt, ist blanker Betrug und in der Kriminalistik anzusiedeln. Hier blüht bereits ein regelrechter Schwarzmarkt und solche Firmen kann man nicht als seriös ansehen. Bitte bringen sie alle Fälle, wo sie unzureichend bedient oder sogar betrogen wurden, bei ihrer zuständigen Kirchenbehörde, dem staatlichen Bauamt und dem Landschaftsamt für Denkmalpflege zur Anzeige. Die Aufhängung und Funktion einer Glocke Eine Glocke hängt an einem zur Schwingungsrichtung der Glocke drehbar gelagerten Balken, das Joch. An diesem Joch ist ein Rad befestigt, das einem Fahradrad ähnlich sieht. Es ist das sogenannte Seilrad und ungefähr so groß, wie der untere Glockendurchmesser. Auf der Radlauffläche ist die Spannvorichtung befestigt sind, an die ein Drahtseil, welches mit einer Kette verbunden, angeschlossen ist. Die Kette läuft dann über ein Zahnritzel am Motor wieder zurück zum Rad, wo das Ende wieder mit Drahtseil fixiert ist. Der Motor zieht die Glocke über eine Steuerung nach rechts und links . Genaue Ermittlung der Seiradgrößen: Schärfendurchmesser der Glocke + 10% bei 500 Touren des Motors, + 20% bei 750 Touren und 35% bei 1000 Touren des Motors pro Minute. In der Glocke ist ein sogenannter Klöppel aufgehangen, der den Ton der Glocke macht. Der zeitgemäße Klöppel besteht von oben nach unten genannt aus dem Blatt, dem Schaft, dem Ballen und dem Schwungzapfen oder auch Vorhang genannt. Sein Gewicht beträgt ca. 4 % vom dem der Glocke. Er schlägt beim Läuten am Glockenschlagring als fliegender Klöppel oben an. Befestigt ist er in der Haubenmitte innen an einer U-förmigen Halterung, durch die ein Bolzen - der Klöppelbolzen - durchgeschoben und festgeschraubt ist. An diesem Bolzen hängt der Klöppel verschraubt an einer Lederlage, die mit einer Metallasche umschlossen ist. Es wurde öfter davon berichtet, daß eben diese Metallaschen Klöppelbolzen brechen lassen. Jedoch sind diese dann nicht korrekt verarbeitet gewesen. Die Lasche muß sauber angepaßt mit dem U-Eisen eine Führung für den Klöppel bilden, daß der Vorhang ein seitliches Spiel bis max. ca 3 cm hat. Ansonsten scheuert das Blatt am Bolzen und beim Läuten der Ballen Material von der Glockenwandung ab, da er, wie es bei kleinen Tischglocken gut zu sehen ist , in der Glocke Rundschläge macht. Das Leder mit möglichst nur einer Lage in der Aufhängung, dient zur Dämpfung der beim Anschlag im Klöppel entstehenden Schwingungen, die sonst den Glockenton stören. Es gibt Firmen, die bauen aus Angst vor einem Bolzenbruch keine Stahllaschen ein. Sie verwenden lediglich mehrfachlagiges Leder. Wieder andere setzen eine Stahlasche mit mehrfachlagigem Leder. Beide Versionen sind falsch. Leder hat eine Eigenschaft: Es ist nichts anderes als Haut und dehnbar. Hängt ein Klöppel nur an Leder, so längt sich dieses im Laufe der Zeit und die Anschlagpunkte des Klöppels mit seinen Masseverhältnissen verschieben sich nach unten und stimmen dann nicht mehr. Daraus folgen dann plattgeschlagene Klöppelballen, beschädigte Schlagringe und ein schlechter Klang. Das gleiche passiert, wenn man die zweite Version verwendet. Die mit mehreren Lagen angefertigte Passung (!) mit Stahllasche geht kaputt, da sich das Leder quetscht und so sich wieder der Klöppel längt. Wenn dann das Blatt zur Seite schlägt, ist ein Bruch des Bolzens möglich, durch Kerbwirkung des Blattes am Bolzen wie bei einer Sollbruchstelle. Das vermeidet man alles, indem man nur eine Lederlage verwendet, bzw. die Passung richtig anfertigt. Der Klöppel muß mit Lasche so stramm um den Bolzen geführt sein, daß er schwer zu bewegen geht ! Ist er dann in der Glocke aufgehangen, so quetscht er durch sein Eigengewicht und beim Läuten das Leder zusammen und bildet so nach ein paar Betriebsstunden, eine leichtgehende Passung. Von anfänglichen Läutproblemen darf man sich nicht ablenken lassen. Das Leder ist mit speziellem Lederfett bei Wartungsarbeiten einzureiben. Bei Stahlglocken sind in den Ballen zusätzlich sogenannte Bronzebacken eingelassen.Dadurch erzielt man ein weicheres Klangverhalten. Sie sollten aber nicht größer als ein 5 DM-Stück sein, was aber wieder von der Glockengröße abhängt. Klöppel dürfen an der Glockenwandung nur einen punktförmigen Abdruck hinterlassen. Tun sie das nicht, so ist die Aufhängung defekt oder der Ballen bzw. die darauf angebrachten Bonzebacken plattgeschlagen. Sind die Abnutzungen am Schlagring noch unter 10% der Schlagringstärke, so kann die Glocke durch eine 45 Grad Drehung am Joch weiter verwendet werden. Auf keinen Fall sollte man die Glocke so drehen, daß die neuen Anschlagstellen genau im 90 Gradwinkel zu den Alten stehen. Dann besteht die Gefahr, daß die Glocke springt, wobei eine 45 Graddrehung die Lebensdauer der Glocke sogar noch erhöht. Wie die Glocke, so hat sich auch der Klöppel im Laufe der Jahrhunderte entwickelt. In vielen alten Glocken in vergessenen Kapellen hängen noch die Hammerklöppel oder Keulenklöppel. Ihr Aussehen gibt ihnen auch den Namen. Diese sind meist nur an einem einfachen Haken in der Glocke befestigt. Sie schlagen beim Läuten den Schlagring unten an. Man spricht dann von einem Fallklöppel. Im 19. Jahrhundert kam dann der Klöppel mit dem Kugelballen auf. Er wurde durch den heute besseren Klöppel mit Elipsoidballen abgelöst. Das neue an den beiden letzteren Klöppeln war eine exakte Aufhängung in der Glocke und eine Verlängerung an dem Klöppelballen, der Vorhang. Damit konnten erstmals Glocken mit fliegendem Klöppel und besten Klangergebnissen geläutet werden. Keulenklöppel und Hammerklöppel sind als Fallklöppel für Handbetrieb konzipiert und dürfen nur in Glocken an überschweren Jochen hängend eingesetzt werden, sofern daß aus denkmalschutzrechtlichen Gründen erforderlich ist. Läutet man Glocken, die mit diesen alten Klöppel ausgestattet sind an einem leichten Joch und mit Maschine, so beschädigen Hammer oder Keule als fliegender Klöppel den Schlagring. Die Glockenjoche Die besten Klangergebnisse erhält man bei der Verwendung von Holzjochen. Da aber viele Sachverständige der Meinung sind, Vollholzjoche seien stabiler als Leimholzjoche, ist es sehr schwierig, entsprechend altes, 100 Jahre abgelagertes Eichenholz zu beschaffen. Es muß aus statischen Gründen diese Holzart sein. Für kleine Glocken bis 100 Kg sind diese luftgetrockneten Balken noch gut zu besorgen, aber wehe der Holzbalken kommt aus der Kammertrocknung, aus dem dann für große Glocken ein Joch gefertigt wird. Dann verbiegt es sich andauernd und die Glocken sind wenigstens nicht ständig richtig festschraubbar am Joch und können schlimmstenfalls aus den Lagern rutschen. Begleitet wird diese Erscheinung von läutetechnischen Schwierigkeiten. Für größere Glocken empfiehlt es sich deshalb, Leimholzjoche zu verwenden. Diese sind aus einzelnen Holzplatten zusammengeleimt, dadurch noch wesentlich stabiler und haltbarer als gleichwertige Vollholzjoche. Voraussetzung ist aber allerdings ein umfangreiches Wissen im Bezug auf Holzverarbeitung bzw. wie man mit Leim und einer Leimpresse umgeht, sowie welche Leimsorte die richtige ist. Dann besteht auch keine Gefahr, daß der Leim schwarz wird. Aber das muß man halt eben gelernt haben. Am besten läuten Glocken an sogenannten Barockjochen. An der Stelle, wo die Glocke mit Schrauben in Güte 8.8 , gebogenen Schmiedeeisen und Flacheisen verschraubt ist, befindet sich ein Holzaufsatz zur Verstärkung und besseren Auswuchtung. Dieser Aufsatz ist beim Barockjoch wohlgeformt geschwungen und genau so hoch, wie das Joch selbst. Viele Billigausführungen haben kleinere Aufsätze, die nur schräg auf der Kreissäge zugeschnitten wurden. Sollten sie aus Kostengründen auf die Idee kommen, eine Glocke an ein Stahljoch zu hängen, dann setzen sie bitte zwischen Glocke und Stahljoch eine wenigstens 4 cm dicke Leimholzplatte zwecks Schwingungsdämpfung vom Glockenton zum Stahljoch ein. Verwenden sie zum Festschrauben der Glocken keine Gewindestangen, da sich die Muttern oben und unten lösen können und man die Materialgüte nicht nachvollziehen kann. Heutiger Standart ist, daß man möglichst nur noch Holzjoche einbaut und Glocken nicht mehr an Stahljochen aufhängt. Die dabei verwendete Aufhängungsart ist die gerade Aufhängung. Das bedeutet, daß der Drehpunkt der Glocke mit dem Drehpunkt der Jochachse fast identisch ist. Die größte freischwingende Glocke der Welt in dieser Aufhängung ist St. Peter ( Dicker Pitter ) im Kölner Dom mit einem Gewicht von 24 Tonnen. Technisch also gar kein Problem. In den neuen Bundesländern und in vielen Kirchen mit Stahlglocken, ist aber noch eine Modeerscheinung in Betrieb: Das gekröpfte Joch, bei dem der Drehpunkt der Jochachse in den Glockenmantel nahe der Flanke gelegen gelagert ist. Der Klöppel ist mit einem massiven Gegengewicht ausgestattet. Derartig aufgehangene Glocken haben klangliche Einbußen zu verzeichnen, wegen fehlendem Dopplereffekt und viel zu langsamer Anschlagsfolge, da die Glocke beim Läuten nur kippt. Darum ist auch das Gegengewicht für den Klöppel notwendig, damit dieser oben am Schlagring anschlägt. Wegen diesem Gewicht sind die Klöppelaufhängungen extrem reparaturanfällig. Trotz der bekannten Nachteile, gibt es immer noch irgendwelche “ Fachleute“, die diese Aufhängung heute noch beim Verkauf von neuen Glocken oder Jochen praktizieren. Glocken müssen an geraden Jochen aufgehangen werden, um das beste Klangergebnis zu erzielen. Noch ein Hinweis: Sollten sie in ihrer Glocke einen dazu passenden, neuzeitlichen Klöppel mit Vorhang haben, der als Fallklöppel läutet, dann ist das Joch zu schwer: Ein paar cm runter vom Holz mit der Hobelbank wirken manchmal wahre Wunder. Aber Vorsicht : Ein historische Joch - 60 Jahre und älter - darf so nicht bearbeitet werden! Kaufen sie dann lieber ein neues Holzjoch, wenns nicht besser geht und bewahren die Struktur des alten Joches, was dann z.B. im Heimatmuseum oder in der Kirche einen guten Platz finden kann. Was ist Intonation ? Glocken läuten im Schwingungswinkel von 70-120 Grad. Wenn man vom Schwingungswinkel redet, dann geht man vom gesamten Winkel aus, daß heißt von einem Ausschwungende zum anderen. Die Ruhelage der Glocke ist der Nulldurchgang: Es ist die Stellung, die die Glocke einnimmt, wenn diese nicht geläutet wird. In der Praxis wird aber nicht der Schwingungswinkel gemessen, sondern man zählt die Anschläge pro Minute und setzt diese ins Verhältnis zum Glockengewicht , z.B. 50 bei 1,8 Tonnen. Hat man mehrere Glocken, so sollte zwischen den Anschlägen pro Minute eine Zahl zwei oder drei liegen, aber nach Möglichkeit gleichmäßig aufgeteilt, damit ein harmonischer Läuterhytmus entsteht. Auf keinen Fall dürfen die Anschlagszahlen zweier Glocken identisch sein, da es sonst zu Schäden im Mauerwerk kommt, abgesehen von dem musikalischen Aspekt. Den Läuterhytmus einer Glocke oder mehrerer Glocken nennt man Intonation. Besonders schädlich für eine Glocke sind neben einem falschen Klöppel oder einer defekten Klöppelaufhängung auch sogenannte Prellschläge des Klöppels, meistens durch zu hohes Läuten bzw. einer falschen Intonation verursacht. In der Kirchengemeinde St. Vincencius zu Scherfede läutet eine Glocke mit einem Gewicht von 1,8 Tonnen mit 46 Anschlägen pro Minute. Gewartet wird die Anlage von Monteuren einer marktführenden Firma aus Herford, die anscheinend seit 15 Jahren nicht merken, daß die Glocke im Winkel von 160 Grad schwingt. Bei genauen Hinhören kommen pro Anschlag Doppeltöne hervor. Das sind Prellschläge, die im Laufe der Zeit den Glockenmantel zerstört haben. Dicke Risse zieren den Innenmantel und ein dumpfer Klang schallt mittlerweile durch Scherfede. Prellschläge können aber auch ebenfalls entstehen, wenn man eine Glocke, zum Beispiel von einem Holzjoch an ein Stahljoch hängt bzw. an der Aufhängung herumbastelt. Die Massenverhältnisse vom Joch zum Klöppel müssen aufeinander abgestimmt sein und das kann nur ein erfahrener Glockentechniker dimensionieren. Die Glocke muß exakt mittig am Joch justiert sein und mit Klöppel lotgerecht hängen. Setzt man sie von Hand in Schwingung mit einem Läutewinkel von 100 Grad, so muß die Glocke mit gleichmäßigen Doppelschlägen eine Zeit lang selbständig läuten, bevor sie mit Einzelschlägen, abwechselnd vom Klöppel an den Anschlagpunkten am Schlagring rechts und links angeschlagen werdend, zur Ruhe kommt. Sie darf nicht nach den Doppelschlägen nur einseitig an der gleichen Stelle angeschlagen zur Ruhe kommen. Erfolgen auch bei geringem Schwingungswinkel von 50 Grad noch Doppelschläge, dann ist der Klöppel zu schwer !! Läutet eine Glocke ungleichmäßig, so ist als erstes zu kontrollieren, ob der Klöppel seitliches Spiel von mehr als 3 cm, plattgeschlagene Anschlagstellen, am Schlagring der Glocke Schleifspuren hinterlassen und beim Anheben unzulässiges Spiel nach oben hat, wodurch Klöppelbolzen brechen können. Dann ist zu schauen, ob der Klöppel mittig in der Glocke sitzt und leicht zu bewegen ist.Findet man hier keinen Fehler, so ist die Glocke auf lotgerechtes Hängen am Joch zu prüfen. Zu diesen Tests und Prüfungen muß die Antriebskette des Motors vom Seilrad abgebaut werden. Ein fliegender Klöppel und ein gerades Joch wird vorausgesetzt. Nach fest kommt ab..... Die Antriebskette, vom Motor zum Seilrad, auch Unterzug genannt, ist keine Gitarrenseite! Viele Firmen spannen die Ketten so stramm, daß man sie deutlich aus dem Geläut heraus ratschen hört. Das ratschen ist nicht so schlimm, aber bedenken sie, daß sie Seilräder auf dem Holz nicht zu 100 % genau rund und mittig zum Drehpunkt der Jochachse montiert werden können. Dazu verbiegen sich die Räder im Laufe der Zeit und werden eierig. Dann bedeutet eine stramm gespannte Kette ein Durchbiegen von Holzbohlen, auf denen der Motor steht, eine Mehrbelastung von Joch und Motorlager sowie ein noch schnelleres Verziehen der Seilräder, vom schlechten Läuten mal abgesehen, was dann wieder einige mit der Motoreinstellung vertuschen wollen. Findet man eine zu lockere Kette vor, so ist als erstes das Seilrad auf seine Rundung und Mittigkeit zu prüfen. Eine Kette darf man nicht bis zum Anschlag stramm spannen! Sie muß, wie beim Motorrad oder Fahrrad, gute 3 cm leicht seitlich zu bewegen sein, darf aber auch nicht bauchig durchhängen. Nur dann kann eine kleine Beule im Seilrad unbemerkt ausgeglichen werden, ohne daß Folgeschäden ( z.B. abgebrochener Motorfuß ) entstehen. Eine zu stramm gespannte Kette ist auch eine weitere Ursache für ungleichmäßiges Läuten. Sind derartige Zustände bei ihnen zutreffend, so beschweren sie sich unverzüglich über die Firma bei den zuständigen Behörden. Sie zahlen viel Geld und haben ein Recht, anständig bedient zu werden. Sie können die Rundung ganz leicht selber prüfen: Gehen sie zur Glocke und stellen sich seitwärts im 90 Grad Winkel zur Glockenschwingung. Schauen sie auf die Oberkante des Seilrades und fixieren sie einen Punkt dahinter z.B. ein naher Holzbalken . Schalten sie die Glocke ein. Wenn dieser Punkt von dem Metall des Rades beim Läuten verdeckt wird, ist das Seilrad verzogen und eiert. Beulen im Rad unter 10 mm sind noch akzeptabel, aber mehr darf es nicht sein. Das Verzinken von Seilrädern ist ein unnötiger Kostenfaktor. Seilräder halten 30 Jahre, dann sind diese verzogen, egal ob sie verzinkt oder rostig sind . Der Rost ist dabei nur oberflächlich und beeinträchtigt in keiner Weise die Stabilität. Dagegen ist das Verzinken von Schrauben und Hängeeisen inkl. Muttern empfehlenswert. Die Motoren und Steuerungen Glocken werden mit Elektromotoren angetrieben. Es sind die im geläufigen Volksmund bekannten Drehstrommotoren. Hier am Motor ist der Einsatz von Widerstandsläufern - ein Läufer ist das rotierende Teil im Elektromotor - stark propagiert worden, da die früher eingesetzten Rundstabläufer lange Einläutzeiten haben. Woher kommt denn diese schnelle Einläutzeit der Widerstandsläufer, von der sich halt viele hinreißen lassen ? Der Grund dafür liegt in der Natur des verwendeten Läufermaterials: eine AlSi-Legierung . Weitere Erklärungen bedürfen elektrotechnischer Fachkenntnisse, wie Lensche Regel und frequenzabhängiges Induktionsverhalten , die hier nicht weiter ausgeführt werden sollen. Jedenfalls erzielt man mit dieser Legierung folgenden Effekt: Im Stillstand haben die Motoren die größte Kraft und werden mit steigender Drehzahl schwächer. Dadurch erreicht man, daß die Glocken in sekundenschnelle zum Läuten gebracht werden. Als weiteren Gedanken hat man dann, daß der Antriebsweg - der Weg, wo im Betrieb der Motor die Glocke zieht - im Bereich der Glockenruhestellung ( Nulldurchgang) liegt. Da hat die Glocke beim Läuten die höchste Geschwindigkeit und der Motor die geringste Power. In der Theorie ist das wunderbar gedacht: Kraftvoll in der Anlaufphase und sanft im Betrieb. Doch in der Praxis sieht das etwas anders aus. Beim Anlauf ist der Motor so kräftig, daß der Klöppel regelrecht vor die Glockenwandung geschleudert wird. Es ist also nicht die Glocke, die so schnell läutet, sondern der Motor reißt sie so, daß der Klöppel frühzeitig an die Glockenwandung schlagen muß. “ Schön die neue Anlage, einschalten und schon läutet es ! “ Bloß wie und warum, danach fragt keiner, denn die neue Anlage ist ja modern und von HEW . Folge: Erhöhter Verschleiß an Klöppel und Glocke im Anlauf, u.a. auch für die gesamte Statik eine wahnsinnige Belastung. Weiterer Nachteil ist der Einfluß von Temperatur und Matrialalterung . Dadurch verändern sich die Reibungsverluste und was schwerer geht, kann nicht so gut schwingen. Doch somit ändert sich wieder die Geschwindigkeit der Glocke und der Motor wird stärker , weil auch er sich langsamer dreht : Unter ungünstigen Bedingungen fängt er an, die Glocke sogar während des Läutens wie im Anlauf zu reißen. Damit kommt diese aus ihrer Pendelfrequenz und dann kommen irgendwelche Mißtöne zu Stande. Vielleicht haben sie schon einmal gehört, daß eine Glocke einmal gleichmäßig schlägt, dann ungleichmäßig aus dem Takt kommt und dann wieder gleichmäßig läutet. Riskant wie der Widerstandsläufer ist auch der Einsatz von hochtourigen Motoren mit einer elektronischen Steuerung. Zwar kann man mit den dabei verwendeten größeren Seilrädern Motorleistung sparen, die Motoren sind viel kleiner, somit von der Optik her ein technischer Fortschritt und haben die besseren Rundstabläufer - diese Läufer haben im Stillstand die geringste Kraft, bei Nenndrehzahl die Größte - , zeigen aber wegen ihrer vollelektronischen Steuerungssystemen kein weiches Läuteverhalten. Bei diesen Systemen, z.B. Hoerz, Perrot, Belgisches System u.v.a. , liegt der Einschaltpunkt ca 50% unterhalb der Nenndrehzahl des Motors und die Glocke wird während des Läutens nur kurz in eine Richtung angeschubst: ca. 200 ms. Der Motor wird also während des Laufes eingeschaltet, wo er bereits eine wesentlich höhere Kraft hat, als im Stillstand, da beim Rundstabläufer die Kraft mit der Drehzahl proportional ansteigt. Somit reißt er die Glocke kurz an und hält sie damit am Läuten. Würde das einem Kind, was auf einer Schaukel sitzt, gefallen ?? Die dabei entstehenden Kräfte in der Maschine sind die Ursache für laute Knälle, die ein Widerstandsläufer im Anlauf ebenso von sich gibt. Diese Motoren haben keine hohe Lebensdauer und sind nach spätestens 10 Jahren defekt. Wenn sie also eine besonders preiswerte Läutemaschine angepriesen bekommen, Finger weg! Die Motoren sind dann aus der hochtourigen Billigproduktion mit Vollelektronik und nur deshalb ist das Angebot so günstig . Für Pastöre, die von Technik keine Ahnung haben, ein gefundenes Fressen, um auf solchen Schabernack reinzufallen. Wenn dann die Anlage montiert ist, kommt die Frage: “ Warum poltert das da oben denn so ?” So etwas ist nur möglich, da der Beratungsauschuß für das deutsche Glockenwesen für Läutemaschinen nur eine Garantiezeit von 2 Jahren vorschreibt. Da können Läutemaschinenhersteller sich das ja erlauben. Haben die Herren in diesem Auschuß jemals handwerklich gearbeitet ? Nur mit Theorie kann man keine Regeln erstellen. Warum haben die Glockensachverständigen keine Ausbildung im Fach Elektrotechnik ? Wenn klarer Sachverstand auch im elektrotechnischen Bereich vorhanden wäre, dann würde so manche Glocke noch in Ordnung sein. Diese Standarts sollten Ihnen sicher sein Beim Rundstabläufer mit niedertourigem Motor bei max 500 Umdrehungen pro Minute kann nichts passieren. Die sehr geringe Kraft im Anlauf ist die besondere Eigenschaft dieser Drehzahl. Denn das Läufermaterial ist hier kein AlSi, sondern einfaches Kupfer. Daher darf man den Motor schon am Umkehrpunkt der Glocke einschalten, sobald diese anfängt, sich in die rückläufige Schwingungsrichtung zu bewegen. Von dort kann man dann die Glocke kontinuierlich bis über den Nulldurchgang hinaus ziehen. Somit ist es ausgeschlossen, daß auf Grund hoher Zugkräfte des Nenndrehzahlbereiches die Glocke gerissen wird, was aber bei einem 500 tourigen oder auch 12 polig genannten Motor von Natur aus wegen seines insgesamt kraftweichen Verhaltens nicht vorkommt. Das schlimmste, was passiert, ist eine etwas längere Einläutzeit der Glocke, wenn’s im Winter mal schwerer wird. Diese Antriebsart kommt dem Handläuten am nächsten. Die Motorleistung in Watt sollte in ganz groben Zügen gesagt gleich dem Glockengewicht sein. Das gilt aber nur beim Antrieb kleinerer Glocken mit diesem Motor, da große tonnenschwere Glocken mit geringerem Schwingungswinkel geläutet werden. Dazu braucht man weniger Motorleistung. Eine schwarze Lackierung des Motors verbessert die Wärmeableitung erheblich, zumal Glockenmotoren keine Lüfter haben und schwarz auch optisch besser ist. Das Verhalten von 500 tourigen Motoren ist insgesamt kraftweich, bei 750 Touren und mehr wird das Verhalten zunehmend krafthart. Würde man hochtourige Motoren so steuern wie 500 tourige, dann hätte man zwar kein optimales Ergebnis, dafür aber doch weniger Probleme. Es entscheidet also auch die Steuerung, welches Betriebsverhalten ein Glockenmotor zeigt. Zwar muß ein guter Motor eben genannte Kriterien mit 500 Touren, Rundstabläufer usw. erfüllen, doch kann er seine Aufgabe nur dann 100 prozentig bewältigen, wenn die Steuerung seine weichen Laufeigenschaften nutzt und nicht einfach so ins Blaue drauf losschaltet. Die richtige Steuerung hat eine kontinuierlich arbeitende Wendeschützschaltung, wo Zeitrelais von Siemens vorgeschaltet sind. Sie schaltet den Motor am Wendepunkt ein, sobald die Glocke sich wieder zurückbewegt. Verwendet man statt der Zeitrelais eine vorgeschaltete Elektronik, so sind inkrementale Meßwertgeber, am Glockenjoch befestigt, zu verwenden. Am besten eignen sich dafür Geräte aus der Siemensproduktion, da diese am besten mit der Simatic SPS als Elektronik funktionieren. Wußten sie schon, daß bei einer Verwendung von einem kleineren Ritzel die Glockenschwingung reduziert und bei einem größeren die Glocke höher läutet ? Das liegt daran, daß ein Drehstrommotor immer auf seine Nenndrehzahl kommen will. Ob er das sanft oder aber mit roher Gewalt macht, sofern er keinen Widerstandsläufer hat, ist, wie sie jetzt wissen, Nenndrehzahlabhängig. Pauschal sollte man sich also nicht blenden lassen von Begriffen wie offener oder geschlossener Regelkreis, High Tech oder modernste Elektronik. Es geht um die Sache, eine Glocke so natürlich wie möglich läuten zu lassen. Es darf also nicht der Motor läuten ! Als Referenz für das Klangbild der Glocke, muß man sich die gleiche Glocke schwingend ohne Motor denken. Jede zusätzliche Belastung durch angeschraubte Bauteile,stramm gespannte Zugketten, zu schwere Seilräder, große Motorkraft durch Widerstandsläufer oder kraftharte Hochtourigkeit, wirkt sich auf den Klöppel aus und er weicht mehr und mehr von dem Referenzschwinger in der Glocke ohne Motor ab. Und da der Klöppel den Ton macht, gilt: Je mehr Belastung man hat, desto künstlicher läutet dann die Glocke. Das schonendste Läuten Man erreicht es man dadurch, das man die Glocke mit einem Motor in Schwingung hält, der eine Zweiphasensteuerung hat. Ein derartiger Antrieb ist absolut stoßfrei, da er im Stillstand überhaupt keine Kraft hat. Diese entwickelt sich mit steigender Drehzahl und entwickelt dann genau so wieder bei fallender Drehzahl zurück. Zum Einläuten wird eine Wendeschützschaltung als Anlaufschaltung verwendet. Neben der schonensten Antriebsweise, ist dieses System auch das sicherste. Den Schwingungswinkel der Glocke kann man bei dieser Antriebsart elektrisch nicht verändern, es sei denn, man beeinflußt die Netzfrequenz. Die ist aber bekanntlich auf 50Hz festgelegt absolut stabil und somit bleibt auch die Schwingungshöhe gleich. Eine Veränderung ist also nur mechanisch mit der Übersetzung Kettenrad -Seilrad möglich. Es existieren keine elektronisch abgespeicherten Werte für Schaltzeiten, Schwingungshöhe etc. , die wie ein Computer abstürzen können. Denn wenn das geschieht, gerät der Motor außer Kontrolle, wie es in der Frankfurter Paulskirche passiert ist. Hier war ein hochtouriger Motor von Hoerz mit preiswerter Vollelektronik für den Glockenabsturz verantwortlich. Der 2-Phasenlauf ist bekannt und hat in den 50er und 60er Jahren hervorragend funktioniert. Und dieses System ist jetzt wieder auf dem Markt mit einem Rundstabläufermotor und elektromechanischer Anlaufsteuerung, wo auch mal der Blitz reinhauen darf, ohne gleich alles zu ruinieren, was bei der Elektronik ein echtes Problem ist. Vertrieben wird es von der Firma Hardehausener Glockenläutanlagen, bei Warburg in Westfalen. Das Bremsen von Kirchenglocken Viele Motoren sind mit Bremsen ausgestattet, die das “ Nachbimmeln “ nach dem Abschalten verkürzen sollen. Die Bremswirkung zum Beenden des Glockenläutens sollte zwischen 3 bis 7 NM liegen. Das heißt, daß eine Glocke trotz Bremse z.B. bei 500 kg noch ca eine halbe Minute nachläuten sollte. Ist die Bremse stärker als dieser Wert, so kann sie nicht lotrecht hängen und es ist ständig mechanische Spannung auf der Kette. Bei kleinen Glocken bis ca. 200 kg können sie auf eine Bremse verzichten, vor allem, wenn es sich um Einzelglocken handelt, da wegen des geringen Gewichtes und der recht kurzen Nachschwingzeit eine Bremse nicht lohnt, zumal eine langsam verstummende Einzelglocke oder ein kleines Glockengeläut viel schöner klingt. Wenn’s denn doch eine Bremse sein soll, dann achten sie darauf, daß nach dem Abschalten nicht sofort Ruhe ist . Die Glocke muß je nach Größe beim Abremsen ca 20 Sek bei 300 kg, 40 Sek bei 1000 kg und 70 Sek bei 2500 Kg nachschwingen. Die Klöppelanschläge dürfen beim Abbremsen nicht lauter werden. Ist das der Fall, so ist die Bremse viel zu stark eingestellt. Eine gute Läutemaschine läßt die Glocke erst bis zu dem Aussetzen der Doppelschläge ausläuten und schaltet dann die Bremse zu. Steht die Glocke, so wird die Bremse noch einmal gelüftet und die Glocke kann sich dann lotrecht auspendeln. Danach wird die Bremse wieder geschlossen. “ Sag mir , wo der NOT-AUS ist .....” An jeder handelsüblichen Standbohrmaschine oder kleinen Kreissäge ist ein sogenannter Not-Aus Taster Vorschrift. Bei den tonnenschweren schwingenden Metallkolossen hält man es aber nicht für nötig, wenigstens an dem Motor und an der Steuerung einen derartigen Taster ( kostet ca. 70 DM pro Stück ) vorzuschreiben. Weiter fehlen in sämtlichen Glockentürmen die Warnschilder, daß man einen elektrischen Betriebsraum betritt und während des Aufenthaltes den Hauptschalter auf Aus zu stellen hat, wie es allgemein Vorschrift ist. Defekte Beleuchtungen oder unzureichende Lampenleistung erhöhen ebenfalls die Unfallgefahr. Sicherheit kostet eben Geld und das will halt jeder sparen. Somit liegt die wahre Schuld beim Verbraucher mit seinem “ sparsamen“ Einkaufsverhalten. Als Faustformel gilt: Der elektrische Betrieb einer Glocke kostet im Jahr 600 DM und die sollte man bei Seite haben. NOT-Aus Taster an der Steuerung, an jedem Motor und sinnvollerweise am Eingang der Glockenstube sichern den Aufenthalt darin. Ein Warnschild : “Elektrischer Betriebsraum” und eine Warnleuchte verdeutlichen die Gefahr, von einer Glocke erschlagen werden zu können. Eine gute Ausleuchtung mit durchschnittlich 500 Lux vermindert die Unfallgefahr. Zudem können sie dann auch sicher sein, daß ihre Glocken anständig gewartet werden: Eine verrostete lockere Schraube kann man im Halbdunkeln nicht erkennen. Gehen sie doch einmal aus Spaß in ihren Glockenturm, prüfen sie die Beleuchtung und spielen dabei Glockenwartungsdienst. Wartungsvertäge: Langfristiges Abzocken ohne Ende Die Wartung einer Glocke dauert pro Mann wenigstens 20 Minuten. Dazu gehört auch ein Läuten der Glocke mit Aufnahme der Anschlagszahl und eine Dokumentation im Bezug auf das gesammte Geläut. Elektrische Klemmstellen sind vom Nachziehen ausgeschlossen, da diese schon bei der Installation einwandfrei sitzen müssen. Sind nach einer Wartung ihrer Glockenanlage noch eben beschriebene Fehler an Glocke, Joch und Klöppel vorhanden, von denen sie nicht unterichtet wurden, so kündigen sie fristlos den Vertrag. Lassen sie sich nicht abspeisen mit beschönigenden Worten. Testen sie die Firma, indem sie bewußt einen Fehler einbauen. Eine lose Mutter an einem Lagerbock ist nicht so gefährlich, aber effektvoll bei der Frage : “ Waren denn auch alle Schrauben fest ? “. Ebenso wirksam ist folgende Gemeinheit: Lösen sie eine Mutter an einer Seilklemme. Besonders peinlich sind durchgebrannte oder lose Tableaulampen in der Sakristei, die bei der Wartung mit geprüft werden müssen, oder aber eine durchgebrannte Sicherung, womit eine Glocke nicht läutet. Beantwortet der Monteur die Frage nach der einwandfreien Funktion mit “ Ja “, so zerreißen sie z.B. mit freundlichem Lächeln vor seinen Augen den Wartungsvertrag. Alles zur Ehre Gottes Abschließend noch eine peinliche Kritik an alle , die glauben, etwas von Glockenläuten zu verstehen. Diese betrifft das Angelusläuten. Er beginnt wie folgt: An der großen Glocke werden drei Anschläge vollzogen. Danach betet man: Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom heiligen Geist. Gegrüßet seiest du Maria, voll der Gnade.... Spätestens an dieser Stelle wird das andächtige Gebet von drei weiteren Anschlägen unterbrochen, die dann nach den Zeilen verlangen: Und Maria sprach: Siehe ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach seinem Wort. Gegrüßet seiest du... Kurz gesagt: Egal wo man hinkommt, haben Läutemaschinenhersteller und Turmuhrbauer keinen blassen Schimmer mehr, wie man den Angelus richtig läutet. Hauptsache, es bimmelt. Wie, das ist egal und weder Glockensachverständige , Pastöre noch Bischöfe etc. ist dieser Mißstand jemals aufgefallen. Ein wahrer Skandal !! Hier jetzt die Weisung für alle: Zwischen den drei Schlägen und dem Läuten der Glocke ist eine Pause von 25-30 Sekunden zu programmieren. Die Pausen zwischen den Anschlägen selbst sollten nicht länger als zwei Sekunden , bei Domglocken max drei Sekunden sein. Das Glockenläuten hat dann eine Länge von einer Minute. An dieser Stelle ist noch einmal die Firma Hardehausener Glockenläutanlagen lobend zu erwähnen, die in allen überprüften Fällen diese Zeiten eingehalten hat und nebenbei gesagt auch mit Abstand den besten Kundenservice bietet. Den Wert einer Firma erkennen sie bei einem spontanen Anruf im Bezug auf die Kompetenz in der Beantwortung ihrer Fragen. Sie haben ein Recht auf qualifizierte Bedienung. Fragen müssen fachgerecht beantwortet werden. Testen sie ihren Monteur durch ortsansässige Meister (Holz, Metall, Elektro) und ziehen daraus Konsequenzen. Glocken müssen wie ein Uhrwerk gleichmäßig läuten. Lassen sie sich nicht abspeisen und treten sie der Firma selbstbewußt entgegen, wenn diese das nicht tun. Melden sie alle negativen Geschehnisse den im Abschnitt Nepper, Schlepper und Bauernfänger genannten Behörden. Nur so kann auf Dauer den schwarzen Schafen endgültig das Handwerk verboten werden. Wenn ihre Anlage von einer großen alteingesessenen Firma gewartet oder repariert wird, die aber ständig neue Monteure zu ihnen schickt, welche ihre Anlage nicht kennen, was sagt das aus: a) über die Qualität der Arbeit, wenn der Monteur versteckte “ Marotten “ der Anlage nicht kennt b) über die Organisation in der Firma und der Firmenphilosophie ? Die Beantwortung der Fragen überlasse ich ihnen, verehrter Leser. Ein letzter Tip: Reinigen sie ihren Glockenturm von Unrat, Tierkadavern und Taubenkot. Damit erhöhen sie die Haltbarkeit der elektrischen, mechanischen Bauteile und die Arbeitsmoral des Glockentechnikers. Veranstalten sie regelmäßige Turmbesteigungen am Sonntag , feiern sie einmal ein Glockenfest und bringen so den Dorfbewohnern die Faszination Glocke in greifbare Nähe. Bernd Ludwig Müller-Lönnendung. |